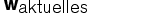|
Andrea Zederbauer
Wahlheimat großer Söhne oder: Die hohe Kunst, Nein zu sagen
Die Mobilisierung im österreichischen „Superwahljahr“ macht auch vor den Kulturschaffenden nicht halt. Die Wortmeldungen einiger Künstler und Künstlerinnen, die überparteilich den amtierenden niederösterreichischen Landeshauptmann Erwin Pröll unterstützten, rückten mit ihrem euphorischen Duktus irritierend nahe an den Jargon parteipolitischer Wahlwerbung heran. Andrea Zederbauer fragt sich, was eigentlich aus der Tradition der Zurückweisung geworden ist.
Aufmerksame Leserinnen und -leser österreichischer Tageszeitungen sind kürzlich auf eine bezahlte Anzeige gestoßen, auf der ein überparteiliches Personenkomitee, bestehend unter anderen aus einigen Kunstschaffenden, dem Landeshauptmann des Bundeslandes Niederösterreich, Dr. Erwin Pröll (ÖVP), seine Unterstützung erklärt. Manche davon liefern auch eine Begründung für ihr Handeln. Den Schriftsteller Franzobel etwa überzeugt Prölls Kunstinteresse und dessen Weitsicht: „Hätten alle Politiker so viel für die Kunst übrig wie Erwin Pröll, sähe die Welt anders aus. Erwin Pröll ist ein Landesvater im besten Sinn, einer der mit den Menschen kann und dabei doch nicht vergisst, auch einmal über die Grenzen zu blicken. Das was er in den letzten Jahren für die Kunst geschaffen hat, ist einzigartig in Europa.“ Für den Fotografen und Verleger Lois Lammerhuber wiederum ist Erwin Pröll „jener kreativ gestaltende Impuls, der den intellektuellen Bogen über 25.000 Jahre Kulturgeschichte von der Venus von Willendorf zur High Tech Welt im MedAustron zu schlagen vermag und damit nicht nur zur völligen Erneuerung Niederösterreichs, sondern auch und vor allem zu einer Neubewertung der Identität seines Heimatlandes.“
Wie dürfen wir uns das Werben um Unterstützung, das Zustandekommen dieser Statements vorstellen? Ein vertrautes Vier-Augen-Gespräch beim Heurigen in der Wachau, persönliche Kontaktaufnahme beim Künstlerbrunch im bischöflichen Sommerrefektorium St. Pölten, Handschlag unter Freunden auf dem Adventmarkt in Grafenegg, ein Brief des Landespressedienstes mit dem dringenden Ersuchen, parteipolitische Differenzen in dieser entscheidenden Stunde doch hintanzustellen, schließlich gehe es um die Regierbarkeit des Landes … und hieße nicht dem Land dienen zugleich der Kunst dienen …?
Hat man auf Seiten der Künstler gezögert, sich untereinander beraten?
Die Namen derer, die der Bitte um Unterstützung Folge leisteten, sind also veröffentlicht. All jene aber, die die Unterstützung verweigert, die Einladung dankend abgelehnt haben, sind – ebenso wie ihre Gründe dafür – in der Öffentlichkeit bislang noch nicht genannt worden. Möglicherweise ist aber auch die Tradition der hohen Kunst, Nein zu sagen, verschüttgegangen.
Zurückweisung als Kunst, wie man sie im Niederösterreich des Jahres 2013 vermisst, stand in den Sechzigerjahren vergleichsweise hoch im Kurs. So schreibt etwa der schwedische Filmemacher Ingmar Bergman am 12. Mai 1960 – kurz nach der Oscar-Gala am 4. April desselben Jahres, bei der die amerikanische Fassung seines Films Wilde Erdbeeren (1959) für das beste Original-Drehbuch nominiert war – an die Academy of Motion Picture Arts and Sciences: „Dear Sirs, As ‚SMULTRONSTÄLLET’ (‚WILD STRAWBERRIES’) didn’t compete for ‚OSCAR’ I think it is wrong to nominate the picture and therefor I want to return the ‚CERTIFICATE OF NOMINATION’. I have found, that the ‚OSCAR’-nomination is one for the motion picture art humiliating institution and ask you to be released from the attention of the jury for the future.“ Genützt hat seine Bitte freilich nichts, Bergman wurde die Aufmerksamkeit der Jury nicht mehr los und erhielt im Jahr darauf für seinen Film Jungfrukällan (Die Jungfrauenquelle) den Oscar für den besten ausländischen Film.
Asger Jorn wiederum, der dänische Künstler, CoBra-Mitbegründer und Situationist, lehnt den internationalen Guggenheim-Preis für sein Bild „Døddrukne Danskere“ („Sinnlos betrunkene Dänen“; 1960 entstanden) ab und begründet sein Nein am 15. Januar 1964 per Telegramm an Harry Guggenheim wie folgt: „GO TO HELL WITH YOUR MONEY BASTARD STOP REFUSE PRICE STOP NEVER ASKED FOR IT STOP AGAINST ALL DECENCY MIX ARTIST AGAINST HIS WILL IN YOUR PUBLICITY STOP I WANT PUBLIC CONFIRMATION NOT TO HAVE PARTICIPATED IN YOUR RIDICULOUS GAME STOP“.
Jean-Paul Sartre befand sich also bereits in guter Gesellschaft, als er seinerseits im Jahr 1964 den Nobelpreis für Literatur zurückwies. Der Spiegel lässt uns in seiner Ausgabe 44/1964 daran teilhaben: „Als Madame Germaine Sorbet, Sekretärin der Sartre-Zeitschrift ‚Les Temps modernes’, am vergangenen Donnerstag kurz vor halb drei die frohe Botschaft in ein Montparnasse-Restaurant trug – Sartre verzehrte dort gerade mit seiner Gefährtin Simone de Beauvoir gesalzene Schweinsrippchen mit Linsen –, hatte sich der Meister längst schon entschieden: Er lehnte Preis und Prämie (220 000 steuerfreie Mark) ab.“ Im Unterschied zu den beiden zuvor Genannten hat Sartre allerdings die Nachricht nicht etwa erst abgewartet, sondern bereits am 14. Oktober dem Sekretär der Akademie in Stockholm brieflich mitgeteilt, dass er, falls vorgesehen, seine Nominierung nicht annehmen werde („Toutefois, pour des raison qui me sont personelles et pour d’autres, plus objectives, qu’il n’y a pas lieu de développer ici, je désire ne pas figurer sur la liste des lauréats possibles et je ne peux ni ne veux – ni en 1964 ni plus tard – accepter cette distinction honorifique.“)
Sieht man vom spanischen Schriftsteller Javier Marías ab, der im Herbst 2012 den Premio Nacional de Literatura für sein Werk Los enamoramientos (Die sterblich Verliebten) mit der Begründung ablehnte, er wolle keine spanischen Staatspreise mehr annehmen, weder von einer rechten PP-Regierung noch von einer unter Führung der Sozialisten, wobei er betonte, dass er manchmal den Eindruck habe „unter den nicht Ausgezeichneten in besserer Gesellschaft zu sein als unter den Ausgezeichneten“ – sieht man von Marías also ab, findet man in jüngerer Zeit eher die Auffassung bestätigt, dass die Welt erst in der Satire zu sich kommt. Folgerichtig daher auch, dass sich ein Brief Sean Connerys vom Dezember 1998 an Steve Jobs – Jobs hätte Connery aufgefordert, in einem Werbefilm für das Unternehmen Apple als Testimonial aufzutreten – als Hoax herausstellte. Dem tatsächlichen Urheber des Schreibens ist es mit der Kunst des Nein-Sagens aber sehr ernst: „Mr. Jobs, I will say this one more time. You do understand English, don’t you? I do not sell my soul for Apple or any other company. I have no interest in ‚changing the world’ as you suggest. You have nothing that I need or want. You are a computer salesman – I am fucking JAMES BOND! I can think of no quicker way to destroy my career than to appear in one of your crass adverts. Please do not contact me again. Best, Sean Connery“
Und der heimische künstlerische Beitrag zur Erhaltung der Form? Mehrfach verdient gemacht hat sich etwa der Dramatiker Peter Turrini. Turrini, Wahlniederösterreicher und der „Unterschriftstellerei“ ablehnend gegenüber eingestellt, hat die Tradition um die Jahrtausendwende mittels einiger Briefe belebt: Schreiben an Mitarbeiter des Diplomatischen Dienstes („Staatsärsche“), den Bürgermeister von Maria Saal („Sie haben die Mühe auf sich genommen, mich zum Ehrenbürger zu machen und es war doch vergebens.“), an Jörg Haider („Und jetzt kommen Sie und wollen ein persönliches Gespräch führen, gerade so, als sei nichts gewesen. Aber es ist zuviel gewesen.“) – alle (wieder) zu lesen im Band Wie verdächtig ist der Mensch?. Und dennoch: Der niederösterreichischen Dialektik des Genres verleiht Turrini bereits zwei Jahrzehnte zuvor gültigen Ausdruck: „Das Nein, / das ich endlich sagen will / ist hundertmal gedacht / still formuliert / nie ausgesprochen. // Es brennt mir im Magen / nimmt mir den Atem / wird zwischen meinen Zähnen zermalmt / und verläßt / als freundliches Ja / meinen Mund.“ (Aus: Ein paar Schritte zurück, 1980)
Die Wahl ist geschlagen, Landeshauptmann Erwin Pröll hat für seine ÖVP 50,8 Prozentpunkte und damit wieder die absolute Mehrheit errungen. Der Pater patriae bleibt den Künstlern erhalten. Für die Res publica wurde eine gute Gelegenheit verpasst, nein zu sagen. Es ist aber nicht die letzte gewesen.
Andrea Zederbauer, koordinierende Redakteurin der Zeitschrift Wespennest, geboren und aufgewachsen in Niederösterreich.
04.03.2013
© Andrea Zederbauer / wespennest
|