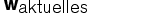|
Bernhard Kraller
Verdachtsberichterstattung. Die Tageszeitung Der Standard, #MeToo und der Fall Toni Sailer
Bernhard Kraller kommentiert das Ausmaß der österreichischen Medienberichterstattung über den ‚Fall Sailer’: Gegen Toni Sailer, Skirennläufer und Cheftrainer des österreichischen Schiverbands, wurden im Jahr 1974 erstmals Vorwürfe der mutmaßlichen Vergewaltigung erhoben und im Zuge der #metoo-Debatte neuerlich aufgegriffen. Ob vermeintlich investigativer Sportjournalismus und kooperative Recherchen zwischen Der Standard, Ö1 und Dossier hier wirklich neue Erkenntnisse bringen? Bemerkungen über Charakteristika einer Berichterstattung.
Experten des Zentrums für Sportwissenschaften der Universität Wien, schreibt der Standard, haben die „qualitätsvolle Recherche“ in Sachen Toni Sailer „gelobt“. Das taten auch der Schriftsteller Martin Pollack in seinem interessanten „Kommentar der anderen“ und der Historiker Oliver Rathkolb in einem Gespräch.
Getragen wurde die vielfach geschätzte Recherche von einer Kooperative bestehend aus Standard, Ö1 und Dossier, mithin von einem Kollektiv von sechs Journalisten in Österreich, zwei in Polen, einer slowenischen Journalistin und zwei österreichischen Rechtsanwältinnen, insgesamt also von elf Fachleuten, die über einen Zeitraum von neun Wochen Akten wälzten und in Archiven stöberten.
Die Ergebnisse der Recherche dienten dem Standard als Kanonenfutter für eine in seiner Geschichte – gemessen an der Bedeutung des Falles – beispiellose Kampagne. Gestartet wurde die Aktion am 17. Jänner mit einer Covergeschichte und Beiträgen, mit denen die Seiten 2, 3 und 4 ausgefüllt wurden. Am 18. Jänner folgte eine Cover-Headline mit einem ganzseitigen Bericht und am 19. Jänner eine weitere Geschichte im Blattinneren, der am 26. Jänner wieder eine zwei ganze Seiten umfassende Geschichte nachgereicht wurde. Daneben gab es Kommentare und Online-Features von Standard, Ö1 und Dossier. Hier wurde also auf Teufel komm raus aus allen Rohren geschossen.
Das macht stutzig, da das Ausmaß der Kampagne umgekehrt proportional zur Bedeutung des zugrunde liegenden Falles ist. Nicht, dass man darüber im Zuge der #MeToo-Debatte berichtet hat, ist bemerkenswert, sondern wie darüber berichtet wurde.
Dabei ist offenbar geworden, dass der Rausch der Investigation auf die Redaktion übergegriffen haben muss, da auch deren Proportionen wahrende Kontrollinstanzen versagten. Etwa in der Passage über die Österreichische Nationalbibliothek. Bloß weil der betreffende Standard-Redakteur in Unkenntnis der Aushebemodalitäten glaubte, man verweigere ihm die Zeitschrift Stern, wird die größte Bibliothek der Republik verdächtigt, „Interventionen zugunsten von Sailer“ getätigt zu haben. Niemandem fiel das Naheliegende auf, nämlich, dass es völlig wirkungslos wäre, eine Illustrierte wie den Stern, die im In- und Ausland zigfach gesammelt wird, an der Nationalbibliothek unter Verschluss zu halten.
Der verständliche Ehrgeiz von Sportjournalisten, auch einmal investigative, gesellschaftspolitische Arbeit leisten zu wollen, hat ihren Preis. Dieser Preis heißt Originalität, und diese lässt sich anhand der Stern-Geschichten von Bernd Dörler falsifizieren.
Der Stern, damals eine sehr einflussreiche politische Illustrierte, hat schon 1975, was der Standard nicht verschweigt, den Fall Toni Sailer in zwei Covergeschichten (Nr. 11 und 13), die durch einen umfangreichen Bericht in Heft 16/1975 ergänzt wurden, aufgedeckt. Der Fall war damit allgemein bekannt und auch nicht mehr aus der Welt zu schaffen.
Vergleicht man die Berichterstattung des Stern aus 1975 mit der des Standard aus 2018, wird die Methode der Kampagne sichtbar: Da das empirische Substrat der Causa seit den Veröffentlichungen vor vierzig Jahren gleich spekulativ und nicht bewertbar geblieben ist – es reicht von „Vergehen“ über „Vergewaltigung“ bis zu „Falle“ –, musste, um eine Kampagne großen Stils aufzuziehen, nur der erzählerische Rahmen, in den dieses Substrat eingebettet wurde, variiert werden.
Etwa, indem man die Kampagne durch Informationen aus dem Akt des Staatsarchivs und dem des Außenamts gefällig aufrüstet oder mit nichtssagenden Wortspenden der beiden noch lebenden und mitbeschuldigten Jugoslawen garniert: „Es kann stimmen, aber in diesen Zeiten war alles anders … Zum Sexuellen werde ich nichts sagen.“ – „Es war ein schlechter Scherz, eine Falle.“
Von ähnlicher Qualität die Statements von zwei mittlerweile pensionierten österreichischen Botschaftsbeamten. Auf die Frage, ob die Prostituierte glaubwürdig gewesen sei, antwortet der eine vage: „Im Prinzip ja.“ Der damalige Botschaftssekretär ist etwas vorsichtiger: „Was genau passiert ist, weiß niemand.“
Last, but not least wird die Berichterstattung durch das wissenschaftliche Interview flankiert, das „Vergangenes historisch artikulieren“ soll, und das heißt nicht, „es erkennen, wie es denn eigentlich gewesen ist“, es heißt, so Walter Benjamin, „sich einer Erinnerung bemächtigen, wie sie im Augenblick einer Gefahr aufblitzt“.
Der Sportwissenschafter Rudolf Müllner und der Historiker Oliver Rathkolb dürfen aber nicht nur interessante Überlegungen anstellen, sie werden auch jeweils – wie das Amen im Gebet – auf die Bedeutung der Standard-Recherche hin befragt, um die journalistische Rechercheleistung zu adeln.
Allen diesen erzählerischen Elementen ist eines gemeinsam: Sie machen mangels neutraler Sachbeweise die Behauptung von Janina S. nicht wahrer und die Gegenbehauptung von Toni Sailer nicht unwahrer. Mit einem publizistischen Trommelfeuer wurde eine Vergewaltigung beschworen, die Toni Sailer nicht nachgewiesen ist und wohl kaum nachzuweisen sein wird. Es gründet einzig auf dem Faktum einer Anzeige und, was kaum zur Wahrheitsfindung in der Sache beiträgt, einer gemeinsamen Intervention der damaligen Regierungen in Österreich und Polen aus Gründen der Staatsräson. Auch zu Sailers Gunsten. Das hat der Stern aber schon vor vierzig Jahren berichtet.
Er hat damals aber nicht nur die angezeigte Vergewaltigung ausführlich besprochen, er hat auch ausführlich die massiven Kämpfe im ÖSV beschrieben, inklusive der Auseinandersetzungen, die ÖSV-Direktor Sailer mit den „kapriziösen Damen“ und Annemarie Moser-Pröll, der „uneingeschränkten Herrscherin des Damenteams“, geführt hat. Und dann hat die Österreich-Ausgabe der Illustrierten bereits 1975 die von Nicola Werdenigg kritisierten Gepflogenheiten im ÖSV thematisiert – wenn auch euphemistisch und ohne Fokus auf möglichen sexuellen Machtmissbrauch: „Amouren von Trainern mit weiblichen Mitgliedern des Teams sind nicht förderlich, denn wie soll ein Trainer ein leistungsschwaches Mädchen aus dem Team nehmen, wenn er mit ihr verbandelt war?“
Das alles hat der Stern also schon vor vierzig Jahren geschrieben – in drei Ausgaben auf insgesamt 18 Seiten. Dass dem so war, habe ich der Lektüre der Standard-Kampagne und dem Geschwurbel um die Rechercheleistung nicht entnommen.
Damit haben die Sportredakteure in der Causa Toni Sailer letztlich doch Originalität bewiesen: indem sie aus dem Fall Toni Sailer auch einen Fall Der Standard gemacht haben.
Bernhard Kraller, Studium der Geschichte und Philosophie, Dr. phil., 1995–2005 Redakteur der Zeitschrift Wespennest. 2018 erscheint bei Sonderzahl der von ihm herausgegebene Band Die angewandte Kunst des Denkens. Von, für und gegen Rudolf Burger. Der oben stehende Text ist Teil einer in Vorbereitung befindlichen Monografie mit dem Arbeitstitel „Der Standard und der Fall Toni Sailer“.
05.03.2018
© Bernhard Kraller / wespennest
|