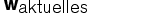|
Jan Koneffke
Von den inneren Zäunen meiner Eltern und der Überwindung des Brenners durch J. W. Goethe
In Zeiten, in denen vielerorts das Trennende über das Gemeinsame gestellt wird, nimmt Jan Koneffke die in der Jugend nur widerwillig gelesene Italienische Reise zur Hand. Das Ergebnis: Vom „Vorzeigeklassiker“ lässt sich hinsichtlich eines respektvollen Umgangs mit dem Fremden noch so einiges lernen.
Johann Wolfgang Goethe stand bei uns daheim nicht hoch im Kurs. Mein Vater, im Dritten Reich groß geworden, Pädagogikprofessor und Marxist, lehnte zwar die Romantiker ebenso strikt ab wie der Geheimrat aus Weimar, denn er betrachtete sie als Vorläufer von Nationalismus und Reaktion. Doch sein Verdikt traf auch den berühmtesten Vertreter des bildungsbürgerlichen Kanons. Das deutsche Bürgertum hatte sich als zu schwach erwiesen, die Nazis zu verhindern, soweit es sie nicht sogar begünstigt und mit der braunen Bande paktiert hatte. Goethes zivilisatorisches Credo angesichts antiker römischer Statuen: „Alles, unser Denken und Sinnen, ist von solchen Gestalten begleitet, und es wird dadurch unmöglich, in Barbarei zurückzufallen“, war von der deutschen Geschichte blutig widerlegt worden.
Auch meine aus einer Arbeiterfamilie stammende Mutter hielt es lieber mit den von Goethe verlassenen Frauen, allen voran der elsässischen Pfarrerstochter Friederike Brion, oder den „gescheiterten“ Dichtern in seinem Umfeld, wie dem vom Geheimrat schlecht behandelten Jakob Michael Reinhold Lenz. Sie war es, die das Steckenpferd der Literatur ritt, nicht mein Vater, dem die Beschäftigung mit Gedichten und Romanen ohnehin nicht richtig seriös erschien. Literatur, das war in seinen Augen – in schönster Kontinuität mit den Vorstellungen des 18. und 19. Jahrhunderts – letztlich eine Sache für seichtere, unwissenschaftliche Gemüter.
Auch wenn meine Eltern sich selten einig waren und sich häufig genug wie die Besenbinder stritten, teilten sie immerhin dieselbe linke und durch die Studentenrevolte radikalisierte Weltanschauung. In meiner Kindheit, den Sechziger- und Siebzigerjahren, dehnten sie ihre ideologischen Vorstellungen auf fast alle Lebensbereiche aus. Was für die Literatur hieß: Die großen und tiefen Romane hatten die Russen (Dostojewski, Tolstoi) geschrieben, an zweiter Stelle folgten die Franzosen (Balzac, Zola, Flaubert), während die kultur- und geschichtslosen Amerikaner keine großen literarischen Leistungen aufzubieten hatten. Der in der Zwischenkriegszeit bei der politischen Rechten beheimatete Antiamerikanismus nistete sich bei der westdeutschen Linken ein und erhielt durch den schmutzigen Krieg der USA in Vietnam tagtäglich neue Nahrung. Zwar ließen sich die Studenten bei ihrer Revolte nicht zuletzt von amerikanischer Musik inspirieren, doch meine Eltern verachteten diesen Einfluss. Jazz, Blues, Rock ’n’ Roll – das alles war „Negermusik“, auch wenn ihnen der Ausdruck nie über die Lippen gekommen wäre.
Es gab noch andere Völker, die bei mir zu Hause keine gute Presse hatten. Dazu gehörten beispielsweise die Italiener. Man sprach zwar nicht viel über sie, und das aus der Wehrmachtsbezeichnung „Itaka“ (für „Italienische Kameraden“) in Wirtschaftswunderzeiten als rassistisches Schimpfwort gegen die italienischen Gastarbeiter hervorgegangene „Itaker“ wurde von den Eltern scharf abgelehnt. Doch als ich, bereits Student, meinem Vater erzählte, dass man im Italienischen gelegentlich einfach ein Wort zur Verstärkung wiederhole, was ich sprachmusikalisch reizvoll fand, meinte er so knapp wie schroff, das belege nur, wie primitiv diese Sprache sei. Ich war zu verdattert, um zu widersprechen.
Bestimmte Sprachen hatte uns, meinem Bruder und mir, der Vater schon zu Schulzeiten madig gemacht. Gegen das Englische, das er „barbarisch“ nannte, empfahl er uns Latein, Altgriechisch und Französisch. Das war eigentlich nur der auf links gestrickte alte bürgerliche Bildungskanon. Unversehens erinnerte der Vater an den deutschen Reisenden Goethe, der kurz nach seiner Ankunft in Rom notiert hatte, die Stadt am Tiber sei von „Naturmenschen“ bevölkert, „die unter Pracht und Würde der Religion und der Künste nicht um ein Haar anders sind, als sie in Höhlen und Wäldern auch sein würden.“ Dieser überhebliche Standpunkt des nordischen „Kulturmenschen“ entsprach den Vorstellungen seiner heimischen Leser und zementierte sie – und er schien auch dem Vater nicht fremd zu sein.
Wenn man es richtig bedachte, war das nur logisch: Er war sechs Jahre alt gewesen, als die Nazis zur Macht kamen, und hatte elf entscheidende Jahre in den nationalsozialistischen Jugend-, Bildungs- und Militäreinrichtungen zugebracht. Dasselbe galt mehr oder weniger für meine Mutter, die darüber hinaus während der letzten Kriegsjahre im Kinderlandverschickungslager von morgens bis abends unter Aufsicht und Einfluss von NS-Lehrpersonal stand. Selbst wenn beide von nationalsozialistischem Gedankengut weit entfernt waren: In der Verachtung meines Vaters für das Italienische feierte nicht nur die Idee kultureller Superiorität fröhliche Urständ, in ihr blitzte auch der rassistische Reflex auf. Das Kind, ja noch der Jugendliche, hatte es den Eltern umstandslos geglaubt: Sie standen auf der moralisch richtigen, aufgeklärten, humanistischen und fortschrittlichen Seite. Doch dieses Bild hatte Risse bekommen.
Das alles fiel mir wieder ein, als ich mich auf einen Vortrag zum 200. Jahrestag des Erscheinens der Italienischen Reise in der römischen Casa di Goethe vorbereitete. Zu diesem Zweck vertiefte ich mich erneut in das Werk, das ich in der Jugend nur mit Widerwillen studiert hatte. Und auf einmal war alles anders: Der begeistert durch Italien reisende Goethe erwies sich als ein Lernender, dem nach und nach die kulturelle Überheblichkeit abhandenkam. Ja, er weist den seinerzeit viel gelesenen Hamburger Reiseschriftsteller Volkmann in die Schranken, der in Neapel zwischen dreißig- und vierzigtausend „Müßiggänger“ beobachtet haben will, und widerlegt nicht nur das Vorurteil des angeblich faulen Südländers. Goethe ist auch von der „trunkenen Selbstvergessenheit“ des neapolitanischen Lebens so hin und weg, dass er sich als „ganz anderer Mensch“ vorkommt: „Entweder du warst sonst toll, oder du bist es jetzt.“
Goethe erkennt das Andere und Fremde an – er ist sich nicht einmal mehr sicher, ob es dem ihm Bekannten und Gewohnten nicht vorzuziehen sei. Und als er 1816 die Italienische Reise veröffentlicht, die er dreißig Jahre zuvor angetreten hatte, hat er sich bereits einem anderen Kulturkreis zugewandt, arbeitet am West-östlichen Diwan. In dem es hellsichtig heißt: „Wer sich selbst und andere kennt / Wird auch hier erkennen: / Orient und Okzident / Sind nicht mehr zu trennen.“
Ich stellte fest: Vom Vorzeigeklassiker, dem vermeintlich „historisch überholten“ Goethe, ließ sich im Zusammenhang mit dem Fremden und Anderen, mit Vorurteilen und kulturellen Grenzen wesentlich mehr lernen, als ich von meinen Eltern hatte lernen können, die das Fremde und Andere nur für einen Schleier vor dem allein herrschenden Gegensatz von Kapital und Arbeit gehalten hatten.
In diesen Zeiten des Zerfalls europäischer Einheit, der Vorurteile, Abgrenzungen und neu errichteten Zäune in alle Richtungen, schien mir Goethe geradezu ein Vorzeigeeuropäer zu sein. Und halb wehmütig, halb resigniert sagte ich mir, dass die scheinbar Sicherheit bietenden Ressentiments ein leichtes Spiel haben, wenn sogar meine Eltern, die vielleicht selbstgerecht, aber doch auch guten Willens gewesen waren, aus den Verbrechen der Vergangenheit zu lernen, sich allzu schwer damit getan hatten, ihre inneren Zäune zu überwinden.
Jan Koneffke, geb. 1960 in Darmstadt. Wespennest-Redaktionsmitglied seit 2004. Er studierte Philosophie und Germanistik in Berlin und verbrachte nach einem Villa-Massimo-Stipendium sieben Jahre in Rom. Heute lebt er als Schriftsteller und Publizist in Wien und Bukarest. Werke (Auswahl): Eine nie vergessene Geschichte (2008), Die sieben Leben des Felix Kannmacher (2011), Ein Sonntagskind (2015).
10.03.2016
© Jan Koneffke / wespennest
|