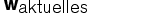|
Florian Baranyi
Letizia Battaglia und das Theatrum Belli
Am 13. April 2022 verstarb die italienische Fotografin Letizia Battaglia, die als Chronistin der sizilianischen Mafia unser Bild von der Cosa Nostra geprägt hat – inszeniert als Szenen eines Stücks mit klar umrissenen Rollen. Florian Baranyi rückt der Theatermetapher in Zeiten von Krieg auf den Leib.
Denkt man an die Cosa Nostra, die sizilianische Mafia, reihen sich schwarzweiße Bilder aus Palermo aneinander. Jenes vom ermordeten Regionalpräsidenten Piersanti Mattarella, Blickrichtung durch das Fenster der Fahrerseite. Vom Toten sieht man nur die Schuhe und Beine, ein Mann kniet neben der geöffneten Beifahrertür, es ist Sergio, jetzt der amtierende italienische Präsident, der den Leichnam seines Bruders aus dem Auto zieht. Das Close-up von Rosaria Schifani, Witwe eines Leibwächters, der beim Anschlag auf Giovanni Falcone starb. Die linke Hälfte ihres Gesichtes ist in Licht getaucht, die rechte dunkel. Beim Begräbnis ihres Mannes sagte sie, sie wäre bereit, seinen Mördern zu verzeihen, aber sie müssten vor ihr auf die Knie fallen und um Vergebung bitten. Luciano Liggio, der Clanchef der Corleonesi, der in schweren Handschellen in den Gerichtsaal stolziert und aussieht, als würde er die Justizbeamten in Ketten vorführen, nicht umgekehrt. Ein Bub, der mit einem Netzstrumpf über dem Kopf und einer Pistole Mafiakiller spielt, ein dürres Mädchen mit einem Stück Brot vor bombengeschädigten Häusern der Kalsa.
Alle diese Bilder stammen von der kürzlich 87-jährig verstorbenen Letizia Battaglia. Sie hat zwei Leben gelebt – erzogen in einer Klosterschule, vom Vater weggesperrt, um ihre „Ehre“ zu beschützen, heiratete sie mit 16 Jahren und erzog drei Töchter, bis das Korsett eines Italiens, das bis 1970 kein Scheidungsrecht hatte, sie fast umbrachte. Sie verließ ihren Mann und begann ihr zweites Leben als Kulturkorrespondentin in Mailand für L’Ora, Siziliens linke, 1992 eingestellte Tageszeitung. Da Artikel mit Bildern mehr einbrachten, begann sie zu fotografieren. Wenige Jahre später ging sie als Cheffotografin für ihr Blatt zurück nach Palermo. Der Soziologe Erving Goffman stellte die einflussreiche These auf, wonach wir in der Gesellschaft alle „Theater spielen“, also Rollen einnehmen, deren Handlungsspielraum dem gesamten Bühnenpersonal mehr oder weniger bekannt ist.
Battaglia hatte die Rolle gewechselt. Damit ging ein Verständnis dafür einher, in welchen Rollen das Personal auf der barocken Bühne Palermos gefangen war, das zeigen ihre Fotos: Die zur Schau gestellte Trauer der Witwen, die eisigen Mienen der Anti-Mafia-Staatsanwälte, selbst die vielen Ermordeten unter Olivenbäumen, in zerschossenen Autos, Nebengassen und Autowerkstätten wirken, als wären sie genau „a posto“, dort wo ihnen die Logik ihrer Rolle das Ende zugewiesen hat. Ihr Rollenwechsel ließ sie mitten in diesem „Bürgerkrieg“, wie sie es später formulierte, auf ein Stück blicken, das selbst noch nicht wusste, dass es zu Ende war und die Szenen des letzten Aktes immer und immer wieder wiederholte. Vincenzo Consolo beschrieb 1982 das Altstadtviertel Il Capo als eine der Bühnenmalereien in diesem Stück: „Hier ist Palermo wie Beirut, zerstört von einem Krieg, der seit vierzig Jahren andauert, es ist der Krieg der Mafia, es ist der Krieg der Mafia gegen die Armen, die Enterbten der Stadt. Der Krieg gegen Kultur, Zivilisation und Menschenwürde.“
Es ist ratsam, mit Theatermetaphern sparsam umzugehen: Ein Theaterstück wirkt nur, wenn man die Dramaturgie dechiffriert – wenn man in der Lage ist, mit den Regiekniffen zu kommunizieren, weiß, welche Affekte es auslösen will und sich darüber amüsieren darf. Über Jahrhunderte durfte das Theater aber als selbstverständliche, verbindliche Metapher herhalten. Ohne Verständnisschwierigkeiten zu provozieren, konnte etwa ein Hörsaal für die Chirurgenausbildung als Theatrum Anatomicum bezeichnet werden: Sektion als dramatischer Akt. Ab dem 17. Jahrhundert sprach man auch vom Theatrum Belli, vom Kriegstheater.
Gemeint war damit ursprünglich der eigentliche Kriegsschauplatz, die Vorderbühne der Schlachten, über den man sich nur über Stiche und Berichte ein Bild machen konnte. Noch im 19. Jahrhundert verwendet der Militärstratege Carl von Clausewitz den Begriff für „einen solchen Teil des ganzen Kriegsraumes, der gedeckte Seiten und dadurch eine gewisse Selbständigkeit hat“. Ein solcher Teil ist für ihn „kein bloßes Stück des Ganzen, sondern selbst ein kleines Ganze, welcher dadurch mehr oder weniger in dem Fall ist, dass die Veränderungen, welche sich auf dem übrigen Kriegsraum zutragen, keinen unmittelbaren, sondern nur einen mittelbaren Einfluß auf ihn haben.“
Das Kriegstheater meint auch Plätze, an denen sich eine eigene Dynamik der Gewalt entlädt, die nur noch bedingt mit den Plänen des Generalstabes korrespondiert, sei es in den Gassen der Kalsa oder Capos oder heute in Butscha. Wie anhand von Battaglias Bildern – die Bedeutung „Schlacht“ ihres Namens ist ein bitterer semantischer Wink der Geschichte – versuchen wir heute anhand von Satellitenbildern ein Massaker zu rekonstruieren. Wir wollen über die Bilder Erklärungen finden, verzweifelt Kausalitäten erzeugen, wo nur die Logik der Gewalt herrschte. Auch wir spielen Theater, spielen unsere Rolle: Zu ihr gehören das Entsetzen, die Hilflosigkeit, der Unglaube. Peter Sloterdijk bemerkte 2004, der Kriegsschauplatz sei längst von einem zweiten überlagert, jenem der Bilder: „der Bilderschauplatz, das theatrum belli des Imaginären, lässt sich vom eigentlichen Kriegsgeschehen nicht mehr sauber trennen. Der Bilderkrieg ist mittlerweile der eigentliche, der immerwährende Krieg.“ Spät in ihrem Leben sagte Letizia Battaglia über ihre Bilder: „Ich wollte sie alle verbrennen. Aber ich verstand, dass ich kein Recht dazu habe. Diese Bilder sind unsere Geschichte.“ Wessen Geschichte wird der Bilderschauplatz des Ukraine-Krieges schreiben?
Florian Baranyi, geb. 1985, Studium der Vergleichenden Literaturwissenschaften, Germanistik und Romanistik. Literaturkritiker und Kulturredakteur bei ORF.at. Wespennest–Redaktionsmitglied seit 2021. Letzte Veröffentlichung: Pier Paolo Pasolini. Eine Jugend im Faschismus (2022, gemeinsam mit Monika Lustig)
05.05.2022
© Florian Baranyi / Wespennest
|