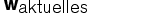|
Florian Baranyi
Krisen im Verdauungstrakt der Geldmaschine
Der literaturhistorische Blick zurück mag der in einen Zerrspiegel sein. Und doch macht er gesellschaftliche Verhaltensweisen im Krisenfall sichtbar, dessen Symptome auf einen Nenner gebracht werden können: kapitalistische Produktion – brennen, bis nichts mehr bleibt. Ein Gegenentwurf, findet Florian Baranyi, müsste auf einen Stoff setzen, der sich nicht vernutzen lässt.
Zeiten des Wandels kommen und gehen, und oft vergisst man, dass man auf gekitteten Bruchstücken wandelt. Das elisabethanische Zeitalter etwa war voller Umbrüche, deren Auswirkungen uns teils derart selbstverständlich geworden sind, dass wir sie gar nicht mehr als kontingent wahrnehmen. Das gilt besonders für die Rolle der Literatur, die als Theater mit Deutungs- und Identifikationsangeboten über Klassengrenzen hinweg erstmals zu jenem Amalgam aus Unterhaltung und Bildung wurde, das uns heute noch – in unterschiedlich wertiger Zusammensetzung – aus jeder Form des seriellen Erzählens entgegentritt, sei es nun Netflix oder Feuilleton. Im hohlen Zentrum der Erzählungen wird nach wie vor eine flüchtige Substanz, ein immer neu zu beschreibendes und zu deutendes „Wir“, eingehegt – denn Kultur lässt sich ja auch als die Summe der lustvollen und selbstzerfleischenden anthropologischen Spekulationen verstehen, die permanent gewälzt werden.
Schon allein aus diesem historischen Zufall heraus funkeln uns shakespearsche Verse aus der Vergangenheit entgegen wie die Splitter eines zerbrochenen Spiegels. Im ersten „Sonnet“ heißt es: „Feed’st thy light’s flame with self-substantial fuel / Making a famine where abundance lies / Thyself thy foe, to thy sweet self too cruel.“ Die Klage des lyrischen Ich gegenüber dem oder der Geliebten bedauert die Selbstgenügsamkeit, das Verschwenden der eigenen Lebenssubstanz als Antrieb. Shakespeare steht in seiner umtriebigen Zeit am Anfang einer Faszinationsgeschichte, die, so Tristan Garcia, von einem Mythos des intensiven Lebens beseelt war. Ein Aufflackern dieser Vorstellung findet sich in der neoliberalen Kampfvokabel „brennen“ – seit Shakespeare brennen wir, am besten für eine Sache, für die wir unsere Lebensenergie als Treibstoff nur allzu gern hergeben. Wobei den Lohn dieser Redoxreaktion selbstredend derjenige einstreicht, der uns die Möglichkeit gibt, für das zu brennen, was uns nun mal umtreibt – Begehren allein führt ja zu nichts. Marx sprach in diesem Zusammenhang vom Abschöpfen des Mehrwerts. Und vielleicht ist das ja die reduzierte politische Formel, auf die sich Machtfragen am Ende unserer treffend betitelten „Petromoderne“ (Benjamin Steininger und Alexander Klose) bringen lassen: Wer verfügt darüber, wer Motor und wer Treibstoff ist?
Diese Frage war so ähnlich schon bei Shakespeare aktuell. Die Sonette lassen sich nämlich auch als Krisennebenprodukt einer kapitalistischen Unterhaltungsindustrie verstehen, entstanden sie doch höchstwahrscheinlich in Perioden, in denen die Londoner Theater wegen der Pest schließen mussten. Und so lässt sich die Zeile „Making a famine where abundance lies” auch als politisches Bittgesuch lesen – die Unterhalter, die in der unfreiwilligen Pause hungern, möge man weiter für ihre Sache brennen lassen. Natürlich erweisen sich die Textsplitter aus vergangenen Zeiten bei genauerem Hinsehen als Teil eines Zerrspiegels, der das Bild nur verformt zurückwirft. Aber die große Klammer zwischen damals und heute ist die gemeinsame Gesellschaftsform. Nancy Fraser benennt in ihrem bewundernswert luziden Band Der Allesfresser nämlich die Vorstellung, wonach es sich beim Kapitalismus um ein Wirtschaftssystem handle, als Irrtum. Vielmehr ist er eine Gesellschaftsform, der „die ihn strukturierenden sozialen Beziehungen so behandelt, als ob sie wirtschaftliche wären“.
Das Wesen des Kapitalismus, so Fraser, sei, dass er die Bedingungen seiner Produktion nicht wieder auffüllt, also stets Raubbau und Diebstahl betreibt, um seine Gewinne zu erzielen. Fraser schreibt von „Kannibalisierung“, welche die Quelle sozialer Instabilität selbst in sich trage. Die kapitalistische Produktion sei ein „Trittbrettfahrer der sozialen Reproduktion, der Natur, der politischen Macht und der Enteignung“ – die immer gehäufter auftretenden Krisen sind also Symptome eines Niedergangs. Der Befund als solcher ist niederschmetternd und geneigt, fatalistisch zu stimmen, andererseits ist der Hoffnungsschimmer schon in der Erklärung eingebettet: Der Niedergang befeuert die Kritik an dem System und fordert Gegenentwürfe geradezu heraus. Das hieß vor gar nicht allzu langer Zeit Counterculture, und schon William S. Burroughs, eine der vielen Gallionsfiguren einer ihrer unzähligen Spielarten schrieb: „And what does the money machine eat to shit it out? It eats youth, spontaneity, life, beauty and above all it eats creativity. It eats quality and shits out quantity. There was a time when the machine ate in moderation from a plentiful larder and what it ate was replaced. Now the machine is eating faster much faster than what it eats can be replaced.“
Apropos historische Rückgriffe: Jetzt, wo die Maschinen nicht nur schnell essen, sondern angeblich auch denken, schreiben und Bilder malen, die Reservate des „Schönen“ ebenso erobert werden, wie Vorstellungen von „Jugendlichkeit“ und „Kreativität“ längst zu Marketinginstrumenten geworden sind, wäre es an der Zeit, zu überlegen, was das „Unnütze“ sein könne, das man heute tun könnte, um nach Günter Eich „unbequem“ zu bleiben und „Sand, nicht das Öl im Getriebe der Welt“ zu sein.
Florian Baranyi, geb. 1985, Studium der Vergleichenden Literaturwissenschaften, Germanistik und Romanistik. Literaturkritiker und Redakteur bei ORF Topos. wespennest–Redaktionsmitglied seit 2021. Letzte Veröffentlichung: Pier Paolo Pasolini. Eine Jugend im Faschismus (2022, gemeinsam mit Monika Lustig)
03.04.2023
© Florian Baranyi / Wespennest
|