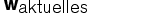|
Ilija Trojanow
Vom Dach gefallen. Überlegungen zum europäischen Zeitgeist
Ob in der Außenpolitik oder im alltäglichen Leben: Gut möglich, dass kommende Generationen in unserer Gegenwart jene Zeit ausmachen werden, in der der Gemeinsinn verloren ging und der Unsinn nicht mehr als solcher benannt wurde. Ilija Trojanow über folgenreiche Blindheiten unserer Epoche und warum zu den zentralen publizistischen Aufgaben auch jene zählt, sich hin und wieder gründlich die Augen zu reiben.
So schwer es ist, sich selber objektiv zu sehen, so schwer ist es, die eigene Epoche halbwegs zutreffend einzuschätzen. Was gegenwärtig wirklich wertvoll ist, lässt sich ähnlich schwer feststellen wie die Frage, wo unsere größten Schwächen liegen, wo wir blind oder gar vernarrt sind. Und doch sehnen wir uns danach, heute schon den Abstand zu unserer Zeit gewinnen zu können, den uns das Morgen selbstverständlich schenkt. Darin besteht die Herausforderung einer politischen und kulturellen Publizistik, die ihren Namen verdient.
Augenfällig werden die Blindheiten gegenüber der eigenen Zeit bei einer Umfrage, die das Goethe-Institut Anfang Mai dieses Jahres veröffentlicht hat. Jeweils 500 Bürger aus anderen europäischen Ländern wurden befragt, was sie über Deutschland wissen und denken. In der Kategorie „Wer ist der bedeutendste Deutsche“ antworteten die meisten, teilweise mit klarer Mehrheit: Angela Merkel. Allein in Italien erreichte die Kanzlerin nicht die Top Ten, was daran liegen mag, dass sie den Ansprüchen der Berlusconi-Ästhetik nicht genügt. Auf die Frage, welches der bedeutendste deutsche Film sei, gaben in fast allen Ländern die Befragten Das Leben der Anderen an, meistens gefolgt von Good Bye, Lenin!. So sind zwar Kritik und Nostalgie gegenüber der untergegangenen DDR gleichermaßen vertreten, mit Sicherheit aber nicht die Höhepunkte des deutschen Filmschaffens benannt. Vielleicht nicht einmal zwei bleibende Werke.
Angela Merkel könnte als Chiffre stehen für eine Perspektive, die weder historische Tiefenschärfe noch einen aktuellen Weitwinkelblick besitzt und der jeglicher Sinn für das Absurde in unserer real existierenden Gegenwart abhanden gekommen ist. Im Gegenteil, das Absurde empfinden wir als vernünftig, sinnvoll und unausweichlich. Wenn auf dem neuen Terminal 5 des Flughafens Heathrow alle Dienstleistungen für den Passagier an den Rand gedrängt worden sind, damit fürstlich Platz ist für die Einkaufsmeilen (48 Geschäfte: „a modern, inspirational, globally sourced collection“), dann stoßen in den engen Durchgängen frustrierte Passagiere immer wieder gegeneinander, mit dem Gepäckwagen durch die Menge, Ellbogen ausgefahren, anstatt die aufgegebene Mitte des gesunden Menschenverstandes wieder zu besetzen.
Als ich letztes Jahr meine minderjährige Tochter in Heathrow 5 an der Kinderbetreuungsstelle abzuholen hatte, drang ich in verwinkelte Ecken des Gebäudes vor, die wir ansonsten nur bei Verfolgungsjagden in Thrillern zu Gesicht bekommen. Auf meine Frage, wieso diese nicht gerade unwichtige Anlaufstelle so abseitig gelegen und so schwer zu finden sei (selbst Mitarbeiter des Flughafens hatten mir einen falschen Weg gewiesen), antworteten die Mitarbeiterinnen, sie würden regelmäßig protestieren, doch vergeblich, gegen die Duty Free Shops kämen sie nicht an, die genössen Priorität, die Betreuung der Passagiere wäre zweitrangig. Die Würde des Menschen ist somit nur noch käuflich zu haben, dafür aber mehrwertsteuerbefreit. Solche Unterordnung des Wesentlichen unter dem Diktat des Überflüssigen – das Erste Gesetz des Zeitgeistes – wird nicht nur hingenommen, ein Zeitgeistphilosoph wie Alain de Botton hat letztes Jahr mit üblich eleganter Feder eine Ode an diesen Tempel der modernen Mobilität geschrieben, ohne jeglichen Sinn für Lächerlichkeiten.
Besonders brutal und unmenschlich sind die Absurditäten unserer Epoche im Bereich der Außenpolitik. Wenn das sprichwörtliche Marsmännchen dieses Jahr zu Besuch gekommen wäre, hätte es sich die Antennen gerieben über die Debatten betreffs „humanitärer militärischer Einsätze“. Zum wiederholten Mal wurden Argumente vorgebracht, weswegen das Töten von Zivilisten ethisch vertretbar sei, um Zivilisten zu schützen. Dann wurde Gaddafis Armee verteufelt, weil sie Streubomben benutzt habe, nur im Kleingedruckten war zu lesen (Marsmännchen haben gute Augen), dass diese angeblich international geächteten Bomben aus Spanien stammten. Überhaupt benutzt weder die libysche noch die syrische oder die jemenitische Armee eigene Panzer, Maschinenpistolen oder Kampfjets, sondern gute solide Tötungsware aus jenen Ländern, die in Gremien wie dem G8 eifrig verhandeln, wie das medial gerade ein wenig inopportune Töten zum eigenen Nutzen gewendet werden kann.
Selbst so genannte Progressive wägen auf der moralischen Skala Bomber gegen Bomber, Tank gegen Tank ab, um das weniger Schädliche auszumachen. Und die IG Metall warnte vor dem Verlust Tausender Jobs in der Rüstungsindustrie (da sollte man konsequent bleiben: das Ausheben von islamistischen Zellen gefährdet Arbeitsplätze in der Terrorismusindustrie), kurz bevor sie zum Ostermarsch unter dem Motto „Frieden schaffen ohne Waffen“ rief. Das Zweite Gesetz des Zeitgeistes ist zweifellos das Dogma des kleineren Übels.
Wo sind die Gedanken abgeblieben, dass es keinen zwingenden Grund gibt, dass Deutschland als weltweit drittgrößter Rüstungsexporteur fast jedes Regime aufrüstet, dass es keinen zwingenden Grund für einen militär-industriellen Komplex oder für die enorme Steigerung der Militärausgaben seit 15 Jahren gibt. Schröder oder Merkel, Kohle- oder Atomkraft, eine Schule – oder Kindergarten schließen: der politische Diskurs ist seit Jahren dominiert von dem Dogma des kleineren Übels, wobei die Unterschiede oft so gering ausfallen, dass man auch von der Illusion einer Alternative sprechen könnte. Wo sind die Stimmen, die darauf hinweisen, dass man die Übermacht der Energiekonzerne sprengen könnte, dass man nicht nur auf nachhaltige, sondern dezentralisierte Stromerzeugung setzen könnte, wenn man nur die visionäre Kraft hätte, das Ende der parasitären Existenz von Großkonzernen zu denken.
Nasruddin Hodscha, der weise Narr unzähliger Volksgeschichten zwischen dem Balkan und Indien, rutschte eines Tages vom Dach und stürzte kopfüber nach unten. Als er an dem Fenster seines Nachbarn vorbeifiel, rief dieser hinaus: „Nasruddin, wie geht es Dir denn?“ Nasruddin rief zurück: „So weit, so gut!“ Daraus lässt sich zwar kein Drittes Gesetz des Zeitgeistes konstruieren, aber als offizielle Anekdote der Europäischen Union erscheint mir diese Geschichte bestens geeignet.
Ilija Trojanow, geb. 1965 in Sofia, wuchs in Kenia auf und lebt heute in Wien. Werke (Auswahl): Der Weltensammler (2006), Der entfesselte Globus. Reportagen (2008), Angriff auf die Freiheit. Sicherheitswahn, Überwachungsstaat und der Abbau bürgerlicher Rechte (gem. m. Juli Zeh, 2009; alle bei Hanser). Zuletzt erschien Fühlend sehe ich die Welt. Die Aufzeichnungen des blinden Weltreisenden James Holman (gem. mit Susann Urban, Malik 2010). Im August erscheint der Roman EisTau im Hanser-Verlag.
11.05.2011
© Ilija Trojanow / wespennest
|