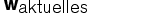|
Lukas Meschik
Der tiefe Riss
Die US-Wahlnacht liegt hinter uns, aber das Ringen um die Gültigkeit eines Endergebnisses ist wie erwartet nach wie vor im Gange. Lukas Meschik versetzt sich zurück ins Jahr 2016, als er den Vorsatz fasste, sich von der Niedertracht des neuen Amtsinhabers nicht anstecken zu lassen. Aber ist das gelungen? Ein Plädoyer für das Kitten der Risse in uns selbst.
Ich erinnere mich an die US-Präsidentschaftswahl im November 2016. Er, dessen Name hier nicht genannt werden soll, hatte monatelang durch rüpelhaftes Verhalten und verbale Untergriffe auf sich aufmerksam gemacht. Beim Rittern um das höchste Amt des Staates wurden ihm großteils nur Außenseiterchancen eingeräumt. Ins Bett ging ich damals wie so viele mit der wohligen Gewissheit, dass mir am kommenden Tag die erste Misses President aus den Nachrichtenportalen entgegenlächeln würde. Aufgewacht bin ich in einer verkehrten Welt, die einen grobschlächtigen Kotzbrocken zu ihrem vielleicht mächtigsten Bewohner auserkoren hatte. Ungläubig schüttelte ich den Kopf.
Auf den initialen Schock folgte eine kurze – wirklich sehr kurze – Phase stiller Euphorie. Wir werden uns wundern, dachte ich, denn es kommt alles ganz anders. Was wir bisher gesehen hatten, war ein kompromissloser Selbstdarsteller im überdrehten Wahlkampfmodus; nun, da die Wahl geschlagen war, würde bald Ruhe einkehren. Solide Menschen würden sich als Berater um ihn scharen und ihn beiseite nehmen, wann immer es ernst wurde und eine Entscheidung von großer Tragweite zu treffen sei. Ich stellte mir vor, wie sich seine geschäftstüchtige blonde Tochter – die der Präsident nach eigener Aussage daten würde, wenn sie nicht verwandt wären – auf seinen Schoß setzte und ihm ins Ohr säuselte: „Daddy, du hast gewonnen, ich bin so stolz auf dich! Und jetzt beweisen wir allen Zweiflern, was für ein netter Kerl du eigentlich bist. Komm, wir überraschen deine Kritiker und retten ein bisschen die Umwelt. Tu es für mich, Daddy.“ Doch mit den ersten Tiraden und Erlässen war die voreilige Begeisterung auch schon wieder verflogen. Gar nichts würde sich ändern, dachte ich, im Gegenteil. Er trieb es immer bunter, oft flankiert von seiner Trophäenfrau mit dem eiskalten Blick. Dabei hätte er nicht einmal besonders anständig sein müssen, nur ein bisschen weniger unanständig als befürchtet. Wie leicht hätte so jemand es gehabt, die in ihn gesetzten Erwartungen zu übertreffen.
Jetzt, vier Jahre später, ist abermals eine Wahlnacht zu Ende gegangen. Und schon länger war uns klar, dass es eine Diskrepanz geben würde zwischen dem eigentlichen „Ausgang“ einer Wahl und der daraus gezogenen „Konsequenz“ – und damit ist keineswegs die historisch begründete Unterscheidung zwischen „popular vote“ und „electoral college“ gemeint. Zwar wurde die Öffentlichkeit mahnend auf eine „Wahlwoche“, gar einen geduldig abzuwartenden „Wahlmonat“ eingeschworen, doch davon werden sich bestimmte Kreise nicht behelligen lassen. Wo Wahrheitsverdreher regieren, dort wird die Wirklichkeit zurechtgebogen, bis sie in jenes Muster passt, das man sich zuvor für sie zurechtgelegt hat.
Ich erinnere mich, schon damals an die Zukunft gedacht und mir eine kommende Wahl vorgestellt zu haben, bei der es um eine Fortsetzung der Präsidentschaft gehen würde. Ein solcher Machthaber würde sich mit unwürdiger Verbissenheit an seinen Thron klammern; eine Demokratie, die ihn dort Platz nehmen ließ, würde immer wieder – und vielleicht einmal zu oft – an ihre Grenzen geführt. Es könnte dann sehr schnell gehen, womöglich schneller als man „tremendous success“ twittern kann.
Eine Figur wie der noch amtierende Präsident ist bekanntermaßen ein Symbol, zum Beispiel für die Ohrfeige, die einer politischen Kaste bei Wahlen verpasst werden kann, wenn die Lebensrealität der Durchschnittsbevölkerung sich allzu sehr verdüstert. Sie ist auch ein Symptom, zum Beispiel für den tiefen Riss, der durch eine Gesellschaft geht und diese nach und nach zu spalten droht. Der Präsident selbst ist zwar nur ein einzelner Mensch, doch um ihn steht ein Ring an Ermöglichern, denen die Regeln des Anstands, die Gepflogenheiten der Diplomatie und die Traditionen der Kompromissfindung lästige Bremsklötze auf dem Weg zu neuen Futtertrögen sind.
Neulich hatte ich einen Traum. Ich stand am Rasen vor dem Weißen Haus und beobachtete die lächerlich überinszenierte Helikopterlandung des Präsidenten, der nach einer kurzen Behandlung im Krankenhaus an seinen Wohn- und Arbeitsort zurückkehrte. Untermalt von heroischen Streicherklängen stapfte er durchs Gras und erklomm einen Balkon, von dem aus er mit steinerner Miene den Kameras salutierte. So weit, so real. Im Traum gab es nun einen Schnitt, und intuitiv verstand ich, dass es sich um „leaked footage“ handeln musste. Der Helikopter – Funkrufname Marine One – stand wieder am Rasen, in seinem Inneren erkannte ich den Präsidenten, wie er am Boden lag und sich unter Schmerzen krümmte. Dieser Anblick bereitete mir große Genugtuung, fast eine Erleichterung. Es tat gut, diesen Mann leiden zu sehen. Zwei Sicherheitsleute kamen hinzu, hoben ihn hoch und banden ihn mit den Füßen an die Decke des Helikopters. Der Präsident wimmerte und strampelte kopfüber. Entlastet das die Lunge, fragte ich mich, kann er so besser atmen? Jedenfalls erfreute ich mich daran.
Als die Erkrankung des Präsidenten durch die Medien ging, war ich voller Häme. Ich wünschte ihm einen möglichst schweren Verlauf. Er sollte keine Luft bekommen, röcheln und rotzen und eitrigen Schleim hervorhusten. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann wünschte ich ihm den Tod an den Hals. Dieses Eingeständnis kommt mit heißer Scham. Erschrocken stellte ich fest, wie die gelebte Niedertracht eines anderen meine eigene befeuerte.
Ich kann mich dunkel daran erinnern, mir bereits 2016 vorgestellt zu haben, wie schwierig es sein würde, das ausgestreute Gift des Präsidenten nicht zu schlucken. Unsere Häme hat ein solcher Wicht nicht verdient; wenn man sich verhält wie er, sich dieses menschenverachtenden Vokabulars bedient, vermehrt man nur seinen Einfluss und den von seinesgleichen. Wahrscheinlich ist das die größte Gefahr, die von den Spaltern und Zündlern ausgeht: Sie legen Stellen frei in uns, mit denen wir nicht einverstanden sein dürfen, lenken uns in eine hasserfüllte Gegenposition. Je größer die Niedertracht, mit der man sich konfrontiert sieht, desto beharrlicher muss man dem eigenen moralischen Kompass folgen. Der Präsident wird bleiben oder gehen – das, wofür er steht, wird immer wiederkehren, überall auf der Welt, direkt vor unserer Nase oder ganz weit entfernt, irgendwann oder morgen oder schon heute. Der tiefe Riss geht nicht zuletzt durch uns selbst, und jeden Tag aufs Neue müssen wir ihn kitten.
Lukas Meschik, geb. 1988 in Wien, Schriftsteller und Musiker, seit Ende 2019 Mitarbeit bei wespennest. Er veröffentlichte Romane und Erzählungen, mit einem Ausschnitt aus seinem autobiografischen Vaterbuch war er 2019 für den Ingeborg-Bachmann-Preis nominiert. Anfang 2020 erschien mit Musik das erste Album seines Musikprojekts Moll, im November 2020 veröffentlicht er seinen ersten Gedichtband Planeten im Limbus Verlag.
05.11.2020
© Lukas Meschik / Wespennest
|