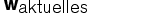|
Walter Famler
Dialektik der Befreiung
Nostalgische Blicke zurück auf die ‚Swinging Sixties’ verdecken jene Aufbruchsstimmung, die um 1967 herrschte: Black Power, Malcolm X oder die Londoner Anti-Psychiatrie-Konferenz zum Thema Dialektik der Befreiung sind nur einige Beispiele dafür. Walter Famler über einige Anliegen, die bereits 1967 formuliert wurden und bis heute nichts an Aktualität eingebüßt haben.
Der im Londoner Exil seiner Eltern geborene Wiener Psychoanalytiker Felix de Mendelssohn leitet seinen in wespennest Nr. 170 veröffentlichten Essay „Orte und Zeiten des Irrsinns“ mit folgender Reminiszenz ein: „Es ist ein heißer Sommertag im Juli 1967. Wir sitzen, viele von uns, im Roundhouse in Chalk Farm in London, wo wir ansonsten gern tanzen, wenn Pink Floyd oder Tyrannosaurus Rex hier aufspielen, aber diesmal geht es um etwas ganz anderes: Vier Psychiater (oder Anti-Psychiater, wie man sie auch gern nennt) – Ronald Laing, David Cooper, Joe Berke und Leon Redler – haben uns ein einzigartiges intellektuelles Happening beschert. Der Dialectics of Liberation Congress findet hier gerade statt, eingeladen, um mit uns zu sprechen, sind unter anderem Gregory Bateson, Paul Goodman, Stockely Carmichael, Herbert Marcuse – Jean-Paul Satre hat im letzten Moment abgesagt.“
Der Summer of Love, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band und Jimi Hendrix, wie er am Monterey Pop Festival seine Gitarre anzündet und zertrümmert: Es sind primär popästhetische Ereignisse, die anlässlich der diesjährigen medialen Jubiläumsfeuerwerke zum 67er-Jahr bislang abgebrannt wurden, keine politischen. Radikale politische Positionen, wie sie am Kongress der Antipsychiater in London formuliert wurden, werden tunlichst nicht aus den Archiven geholt. Und so wird die Wahrnehmung erzeugt, es hätten primär Sound und Moden der Swinging Sixties nachhaltige Wirkung, nicht aber Black Power, Malcolm X, Marcuse, Pasolini und die Proteste linksradikalisierter Studenten in Berkeley, Paris, Frankfurt, Belgrad und Prag. Im Gegensatz zur Aufbruchsstimmung um 1967, getragen von der konkreten Utopie einer greifbar erscheinenden Befreiung von Unterdrückung und Massennot, ist heute die Hegemonie im politischen Diskurs längst wieder bei der Rechten, die, wo opportun, vormals linke Protestformen für ihre Zwecke instrumentalisiert und, wo an die Macht gelangt, mit der ohnedies längst atomisierten Linken endgültig abrechnen möchte. Auf plumpe, aber wirksame Weise wird dabei die Schuld für alle durch einen ungezügelten Kapitalismus sichtbar werdenden gesellschaftlichen Verwerfungen „den Linken“ in die Schuhe geschoben. Die ökologischen werden ausgeblendet.
Es ist an der Zeit, an ein paar verdrängte Manifeste radikaler Analyse gesellschaftlicher Repressionsmechanismen zu erinnern, etwa an David Coopers Tod der Familie oder Ronald D. Laings Das geteilte Selbst. Im Wiener Verlag Bahoebooks wird im Oktober eine kommentierte Neuedition des von David Cooper herausgegebenen und auf Deutsch ursprünglich in der legendären Reihe rororo-aktuell publizierten Dokumentation des Londoner Kongresses erscheinen. Ihre Aktualität haben einige der damaligen Beiträge bis heute nicht eingebüßt, auch im Vergleich mit Buchveröffentlichungen neueren Datums. Wenn Paul M. Sweezy 1967 schreibt: „Entwicklung auf der einen und Unterentwicklung auf der anderen Seite bedingen sich in dialektischer Weise gegenseitig. Darin besteht von Anfang an die ganze Geschichte des Kapitalismus. (…) Es sind die beiden Seiten der kapitalistischen Medaille (…). Und wenn man das nicht begreift, wenn man daran nicht täglich denkt, dann wird man immer und immer wieder von der Propaganda irregeführt, die zusammengehörige Dinge zu trennen versucht (…), um uns weiszumachen, wir könnten das eine ohne das andere haben“, so könnte dies aus einer Besprechung von Stefan Lessenichs derzeit viel diskutiertem Buch Neben uns die Sintflut stammen. Und wenn Herbert Marcuse formuliert, dass der kapitalistische Wohlfahrtsstaat im Kern ein Rüstungsstaat ist, der einen totalen Feind braucht, denn „die Perpetuierung des erbärmlichen Existenzkampfes (…) intensiviert in dieser Gesellschaft eine elementare Aggressivität, die wohl noch nie in der Geschichte ein solches Ausmaß erreicht hat“, so könnte dieser Befund genauso gut dem heuer erschienen Buch Imperiale Lebensweise von Ulrich Brand und Markus Wissen entnommen sein.
Die Orte des kapitalistischen Irrsinns haben sich in den letzten Jahrzehnten gravierend verändert. Seine Zeiten wurden digitalisiert und er ist allumfassend geworden. Seine Logik ist die gleiche geblieben. Das kollektive Wir in Mendelssohns Reminiszenz wurde durch ein gläsernes Ich ersetzt, das sich durchgängig zu prostituieren hat und bei intensivierter Selbstausbeutung noch den perfidesten Ästhetisierungszwängen sich unterwirft. Massenhaft produziert werden hedonistische Monaden, die sich jeder Kontrolle freiwillig ergeben. Konsum wird als Freiheitsterrain simuliert, auch dann noch, wenn er sich für Sozialhilfeempfänger meist nur mehr im Schaufensterblick erschöpft. Das alles bei forcierter atmosphärischer Faschisierung aller Lebensbereiche, auf die die Masse der Verlierer programmiert wird, und die – etwa bei den Protesten gegen den G20-Gipfel in Hamburg – durch paramilitärisch organisierte Polizeieinsätze konkret wird. Wer sich weiter noch auflehnt, wird ausgemustert oder erhält, wenn noch Anpassungspotential prognostizierbar ist, ein Therapieangebot, das Unterwerfung und Profit für die Pharmaindustrie gleichzeitig sichert.
Herbert Marcuses Aufforderung zu einer Befreiung des Menschen von einer Gesellschaft des Überflusses, die ihn „früher oder später zum Barbaren werden lässt, ohne dass er es merkt“, hat in den fünfzig Jahren, seit sie beim Kongress Dialektik der Befreiung in London formuliert wurde, nichts an Aktualität verloren. Die Voraussetzungen für solch eine Befreiung waren allerdings 1967 noch um einiges hoffnungsvoller zu bewerten als heute. Die Rolle der Intellektuellen im Befreiungsprozess hat Marcuse schon damals als begrenzt definiert. In den letzten Sätzen seiner Rede warnt er diesbezüglich sowohl vor Illusionen als auch vor Defätismus. Auf seinem Grabstein am Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin steht: Weitermachen.
Walter Famler, geb. 1958 in Bad Hall/OÖ, lebt in Wien. Generalsekretär Alte Schmiede/Kunstverein Wien und Redaktionsmitglied der Zeitschrift Wespennest. Zuletzt erschien Exiled on Sidestreets, eine Monografie über den ungarischen Künstler Tamás Bakos (hg. gemeinsam mit A. Bakos und R. Öhner, Sonderzahl 2015).
29.09.2017
© Walter Famler / wespennest
|